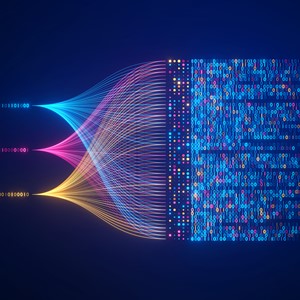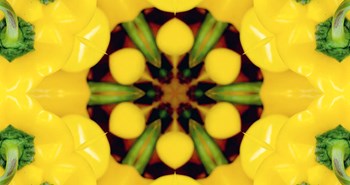Die Schweiz ein Entwicklungsland in Sachen Digitalisierung? Ist Land mit zwei weltbekannten Hochschulen, zahlreichen wissenschaftlichen Instituten und erfolgreichen Start-ups während einer Pandemie technologisch komplett überfordert? Die Corona-Krise hat die Versäumnisse offengelegt. Der Klassiker: Die Faxgeräte, die einige Ärzte und Spitäler zu Beginn der Krise noch für die Übermittlung von Daten benutzten. Dazu endlose Excel-Tabellen, unübersichtliche Webseiten, Registrierungsprobleme für Impfwillige oder eine private Organisation, die sich der Koordination der freien Betten in der Schweiz annehmen muss.
BAG spielt Feuerwehr
«Erschreckend» sei es für ihn vor einem Jahr gewesen, zu sehen, «wie analog die Prozesse rund um das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch ablaufen», sagt Andreas Wicht, promovierter Medizin-Informatiker und Experte für Digitalisierung im Gesundheitswesen bei der Unternehmensberatungsfirma Synpulse. «Sämtliche Prozesse waren nicht auf eine solche Situation angelegt».
«Ein Armutszeugnis», auch für Alfred Angerer, Gesundheitsökonom und Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Doch niemand, der sich mit der Materie auskenne, sei überrascht worden, "dass nicht gut genug kommuniziert wurde. Seit Jahren hätten die Experten betont, dass endlich Schluss sein müsse mit Papier und CDs. «Und als dann das Haus brannte, war es schon zu spät», sagt Angerer. «In Wochen kann man nicht die Versäumnisse von Jahren aufholen». Seit Beginn der Pandemie sei dem BAG deshalb nichts anderes mehr übriggeblieben, als Feuerwehr zu spielen, ergänzt Wicht. Was gefehlt habe, sei ein gesamtheitlicher Ansatz, "den gesamten Prozess digital zu denken».
Ideenwettbewerb mit Experten
Genau diesen Punkt kritisiert auch Angerer: Nicht, dass das BAG in der Pandemie perfekt hätte funktionieren müssen, «sondern dass es kein System geschaffen hat, das agil auf Unvorhergesehenes reagieren kann». Denn ein solches Vorgehen wäre durchaus denkbar gewesen, sagt Angerer: «Die Dringlichkeit war da, die Gelddiskussion stand nicht im Vordergrund. Man hätte schnell über unkonventionelle Lösungen nachdenken sollen». Er hätte zum Beispiel einen Hackaton vorgeschlagen, einen Ideenwettbewerb, um das Wissen der Experten in der Schweiz «abzusaugen», abseits der Politik. Auch hier stimmt ihm Wicht bei: In der Schweiz gebe es so viele Technologie-Anbieter, das Know-how sei vorhanden. Das BAG hätte in einer solchen Situation schneller auf innovative Player zugehen müssen, um gemeinsam mit diesen Ideen voranzutreiben und umzusetzen. Die Verantwortlichen hätten zwar versucht, pragmatische Lösungen umzusetzen. Aber sie hätten wohl noch nie so vielfältige Bedürfnisse befriedigen müssen, von Spitälern und Ärzten über Kantone, Experten und nicht zuletzt der Bevölkerung. Und so seien Webseiten entstanden, «aufgebaut wie aus der Feder eines Juristen».
Als einen seltenen «Leuchtturm von Digital Health» bezeichnet Angerer die SwissCovid-App. Dieses Unterfangen sei aus Informationssicht gelungen. «Eine zentral angestossene Aktion, unter Beteiligung dynamischer Softwareunternehmen und mit einer Lösung für die sensiblen Daten, offen kommuniziert und umgesetzt unter Einbezug der Sorgen der Menschen».
Der Wille fehlt
«Streng wissenschaftlich» sei es schwierig, den Nutzen der Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung im Einzelnen abzuschätzen, sagt Wicht. Sicher sei jedoch, dass in einer nicht-digitalisierten Welt Fehler und Missstände oftmals schlicht unbemerkt blieben. Und in einer Pandemie erscheine es ihm logisch, dass die Wahrscheinlichkeit für bessere Entscheidungen steige, je besser die Datenlage sei. Vor allem aber müssten die Probleme in einer pandemischen Lage auf nationaler Ebene gelöst werden.
Die Schuld für das Scheitern der Digitalisierung im Gesundheitswesen sieht Angerer beim fehlenden Willen aller Beteiligten. Es gebe bei den Akteuren und in der Politik zu viele Partikularinteressen und keinen Konsens für einen einheitlichen Fluss von Daten und einen Informationsaustausch. Auch die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor dem gläsernen Patienten und die Angst vor Datenmissbrauch seien am digitalen Rückstand nicht unschuldig. Und schliesslich hapere es bei der Kommunikation der Vorteile, also wie die Menschen von einer Digitalisierung profitieren könnten. Dieser Punkt sei das grosse Dilemma der Prävention im Allgemeinen: «Heute die Kosten für eine Organisation, morgen der Nutzen für alle». Daran scheitere auch der Föderalismus. Und deshalb liege es allein am Bund, die Digitalisierung voranzutreiben, wenn nötig auch mit ein bisschen Zwang, meint Angerer. (Benno Lichtsteiner, Keystone-SDA)