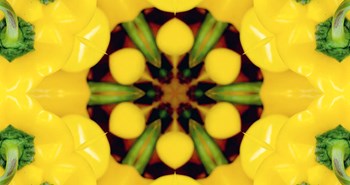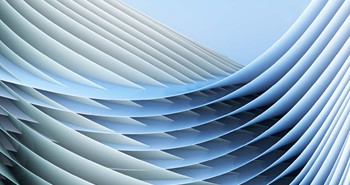Die Zahl der Pensionierten wird in den nächsten zehn Jahren um 26% steigen.[1] Die Finanzierung der Altersvorsorge wird in allen drei Säulen anspruchsvoller. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind gefragt. Zu wissen, wie die eigene Vorsorge aussieht, wird damit für immer mehr Menschen immer wichtiger. Trotzdem bleibt das komplexe Zusammenspiel innerhalb des schweizerischen Vorsorgesystems für die meisten Betroffenen eine «Blackbox».
Andere Länder zeigen, dass es auch anders geht: Digitale Pension Tracking Systeme (PTS) bieten Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Übersicht über ihre Altersvorsorge. In der Schweiz fehlt eine solche Lösung. Die Folge? Bürokratie, Unsicherheit und eine Altersvorsorge, die für viele zum Blindflug wird.
Mehr Pensionierungen, wenig Klarheit
Der starke Anstieg der Anzahl Pensionierter erhöht einerseits den Druck auf die Durchführungsstellen in der 1. Säule und andererseits auf die Pensionskassen und die Stiftungen der 3. Säule. Eine höhere Produktivität ist gefragt, und eine bessere Information und Übersicht für die Versicherten ist dringender denn je.
Studien zeigen, dass Menschen ihren Finanzbedarf im Alter systematisch unterschätzen, während sie zugleich die Werthaltigkeit ihrer Ersparnisse überschätzen.[2] Das kann nicht nur im Zeitpunkt der Pensionierung zu bösen Überraschungen führen, sondern – langfristig betrachtet – auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, auf Ergänzungsleistungen oder gar Sozialhilfe angewiesen zu sein.
Eine Befragung zeigt, dass zwar 55% der Bevölkerung die 2. Säule als entscheidend für ihre Ruhestandsplanung ansehen, gleichzeitig wünschen sich aber 24%, alle relevanten Vorsorgedaten an einem Ort einsehen zu können.[3]
Wenn der Überblick fehlt – Annas Vorsorgedilemma
Nehmen wir das Beispiel von Anna, 51 Jahre alt, die sich Gedanken macht, wie ihr Leben im Zeitpunkt der Pensionierung aussehen soll. Sie hat bisher in verschiedenen Branchen gearbeitet und Beiträge in unterschiedliche Pensionskassen eingezahlt. Mit der Möglichkeit, ihr Alterskapital flexibel und zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu beziehen – sei es als Kapitalauszahlung, monatliche Rente oder eine Kombination daraus –, steht sie vor komplexen Entscheidungen. Zusätzlich hat sie in der 3. Säule über Jahre hinweg steuerprivilegiert Ersparnisse angesammelt, deren Auszahlung sie ebenfalls planen muss.
Ihr Dilemma: Jede Option hat erhebliche finanzielle, steuerliche und langfristige Konsequenzen. Anna muss mühsam Informationen von Ausgleichs- und Pensionskassen, Banken und Versicherungen zusammentragen, um ihre finanzielle Zukunft planen zu können. Ohne eine zentrale Übersicht kann sie keine Szenarien durchspielen und bleibt auf aufwendige Einzelanfragen angewiesen.
Ein gut entwickeltes PTS würde Anna in dieser für sie anspruchsvollen Situation mit wenigen Klicks eine Übersicht liefern und zeigen, wo sich allenfalls Lücken befinden bzw. welche Handlungsmöglichkeiten sie hat. Sie hätte damit auch die Möglichkeit, selbständig verschiedene Szenarien zu simulieren und zu erkennen, welche Kombination von Renten- und Kapitalbezug für sie langfristig die beste Lösung darstellt. Ebenfalls könnte sie rechtzeitig Massnahmen einleiten – z.B. den Einkauf in ihre Pensionskasse erhöhen.
Ein Blick auf internationale Entwicklungen
Das Beispiel zeigt, wie relevant das Thema ist. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Diskussion um Digitale Pension Tracking Systeme (PTS) zunehmend an Fahrt gewinnt.
Europa ist der Schweiz hier voraus: Dänemark, die Niederlande und Deutschland entwickeln bereits nationale Plattformen, die Versicherten eine zentrale Übersicht über ihre Rentenansprüche bieten sollen. Dies stärkt nicht nur die Vorsorgeplanung, sondern auch das Vertrauen in die Altersvorsorge. Besonders Dänemark zeigt, dass durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Behörden sowie Verbänden (Arbeitgeber und Versicherer) eine hohe Akzeptanz erreicht wurde.[4]
Die Situation in der Schweiz
Die Digitalisierung der 1. Säule macht mit dem Mosar-Projekt Fortschritte. Das Ziel von Mosar ist es, wichtige Informationen wie individuelle Kontoauszüge online bereitzustellen, wodurch Bürgerinnen und Bürger einen besseren Zugang zu ihren Vorsorgedaten erhalten. Dies ist ein wichtiger erster Schritt zur Modernisierung der Sozialversicherungen.
Diese Fortschritte bleiben jedoch wirkungslos, solange die 2. und die 3. Säule nicht einbezogen werden. Die berufliche Vorsorge ist allerdings hoch fragmentiert, mit vielen Stakeholdern, was Veränderungen besonders erschwert.
Michael Müller, Leiter der Arbeitsgruppe «Open Pension» (SFTI), führt in einem Interview zu PTS aus, dass offene Schnittstellen im Sinne von Open Finance der Schlüssel zu einem funktionierenden PTS sind. Doch genau diese fehlten in der 2. Säule. «Es gibt keine standardisierten Schnittstellen für den Datenaustausch. Zudem fehlt eine Governance, die alle Stakeholder einbindet.»[6]
Gleichzeitig zeigen aktuelle parlamentarische Initiativen, dass das Thema PTS politisch zunehmend an Bedeutung gewinnt: Ständerat Erich Ettlin hat eine Motion eingereicht, die den Bundesrat beauftragt, ein nationales PTS zu prüfen. Dieses System soll es den Versicherten ermöglichen, ihre Ansprüche aus der 1. und der 2. Säule sowie der privaten Vorsorge (3. Säule) zentral einzusehen.[7] Nationalrat Marcel Dobler fordert in einer weiteren Motion, dass der Bundesrat die rechtlichen Grundlagen schafft, um den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen zu erleichtern und ein solches PTS zu ermöglichen.[8] Diese Motionen unterstreichen die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat, Pensionskassen und privaten Anbietern, um eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung zu realisieren.
Und auch seitens der Fachverbände steigt der Druck: Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP hat seine Mitglieder im August 2024 zur aktiven Förderung der Digitalisierung aufgerufen,[9] und erste Initiativen wie das Open-Pensions-Projekt der Swiss Fintech Innovation setzen sich ebenfalls für eine Modernisierung ein.[10]
Technologie ist nicht das Problem
Wie Michael Müller in seinem Interview oder Christian Dreyer und Stephan Widmer in ihrem Artikel «Der nächste Schritt Richtung Öffnung» betonen: Das Technische ist im ganzen Kontext der PTS-Diskussion nicht die eigentliche Herausforderung, sondern das Zusammenspiel aller involvierten Player.
Eine Lösung, die es den unterschiedlichen Interessensgruppen einerseits erlauben würde, die Daten aus ihren jeweiligen Verwaltungssystemen in einem Versichertenportal zur Verfügung zu stellen («read»), und es andererseits den Versicherten ermöglicht, ihre Daten nicht nur einzusehen, sondern auch lebensereignisbasierte Prozesse anzustossen («write»), wird z.B. von der Neosis AG, einer ELCA-Tochter, angeboten. Ihre «iPension Suite» bietet modulare B2B- und B2C-Lösungen mit Schnittstellen zu allen am Markt bekannten Verwaltungssystemen der drei Säulen. Die jeweiligen Module lassen sich aufgrund ihrer Agnostizität nahtlos in jede bestehende Systemumgebung integrieren. Der vollständig datenbasierte Ansatz unterstützt zudem die Ablösung von der Arbeit mit Dokumenten und stellt damit zugleich die KI-Fähigkeit sicher.
Nutzerfreundliche Lösung jetzt entwickeln
Pension Tracking Systeme sind der Schlüssel zu einer transparenten und effizienten Altersvorsorge. Die Schweiz hat jetzt die Chance, eine nutzerfreundliche, digital vernetzte Lösung zu entwickeln. Die Technologie ist da. Was es jetzt braucht, ist der Wille aller Akteure, sie auch umzusetzen. Die Zeit ist reif.
Take Aways
- Blackbox Pensionierung: Die Zersplitterung der Systeme macht es Versicherten nahezu unmöglich, ihre finanzielle Situation im Alter einfach und klar zu überblicken.
- Wachsende Herausforderung: Die steigende Zahl an Pensionierungen und flexiblere Ruhestandsmodelle setzen die Durchführungsstellen unter Druck – es braucht jetzt einen digitalen Schub, um die Produktivität zu erhöhen.
- Lösungen sind da: Pension Tracking Systeme (PTS) bringen Transparenz, beschleunigen die Digitalisierung und senken den administrativen Aufwand.