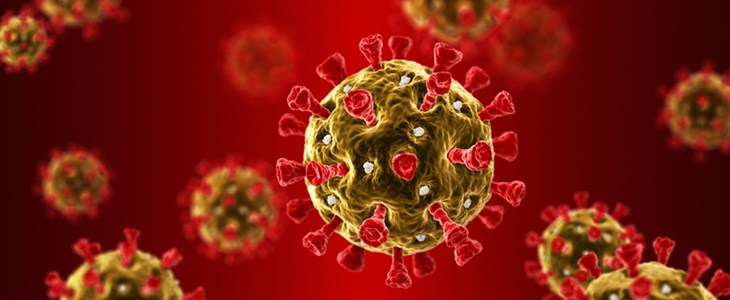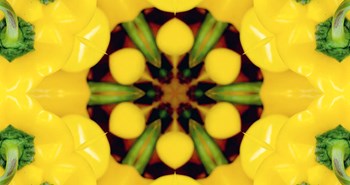Wie behandeln Sie die Patientinnen und Patienten?
Die nicht-pharmakologischen Therapien stehen im Vordergrund. Dort wissen wir mittlerweile wirklich, was hilft. Manche sagen, sie schaffen keine 100 Meter Spaziergang. Wenn der Akku ganz leer ist, gibt es häufig eine Verschlechterung der Symptome: Müdigkeit, Schmerzen, Hirnnebel, Kopfweh und so weiter. Dies kann auch die Krankheitsdauer negativ beeinflussen. Um dies zu verhindern, werden diese Leute alle im Energiemanagement geschult. Dort geht es sehr viel um Struktur: Wie plane ich meinen Tag? Was setze ich für Prioritäten? Wo schalte ich Pausen ein? Kurz: Inhaltlich relativ langweilig, aber sehr effizient, um die Symptome in Griff zu bekommen. Das ist die Basis. Ohne das Energiemanagement gibt es einfach niemanden, der sich verbessert.
Muss man lernen, dass man sich Sorge trägt?
Ja, man kann es vielleicht so sagen, wobei es sich für viele wie das Gegenteil anfühlt, weil die meisten Betroffenen es eigentlich gewohnt sind, sehr viel zu leisten. Die Patienten verstehen das alles zwar sehr schnell, aber das Umsetzen ist dann häufig nicht so einfach. Viele laufen immer wieder in Überanstrengungen und erleben dann einen Schub oder einen Crash, wie häufig gesagt wird.
Wichtig ist, dass man den Akku nie ganz leer gehen lassen soll?
Ja, so sagen wir das den Patienten. Wir haben auch ein eigenes Physiotherapieprogramm aufgestellt. Die klassische Physiotherapie, in der man relativ schnell eine starke Steigerung der Belastung herbeiführt, kann kontraproduktiv sein. Das heisst, man muss dort mehr passiv arbeiten, mehr auf Entspannungstechniken zurückgreifen.
Gibt es auch medikamentöse oder pharmakologische Behandlungen, die wirken?
Nein. Hier gibt es nur «Off Label», es gibt noch kein zugelassenes Mittel. Wir behandeln die Symptome, aber wir haben bis jetzt keine Therapie, um diese Krankheit ursächlich anzugehen. Es gibt Studien, die dazu laufen, aber bis jetzt gibt es noch kein Mittel.
Was sind die Erkenntnisse?
Medikamentös sehen wir gute Effekte für spezifische Symptome. Wir haben gute Medikamente für Kopfweh, für Muskelschmerzen, Schlafstörungen und für Leute, die sehr viel Angst haben oder eine Panikstörung entwickeln. Es gibt Leute, die sekundär eine Depression entwickeln. Alle diese Beschwerden können wir medikamentös behandeln, ohne aber dass wir die Krankheit deswegen zum Verschwinden bringen.
Was ist bei der Wiedereingliederung ins Berufsleben zu beachten?
Am Anfang gab es einige Patienten, die aufgelaufen sind. Es ging ihnen besser und sie fingen wieder an zu arbeiten, vielleicht auch mit einem Teilzeitpensum. Dann merkten sie aber, dass sich ihr Befinden verschlechterte und sie fielen wieder aus. Darum fangen wir bei den schwer Betroffenen, die über Wochen oder Monate von der Arbeit weg waren, langsam an, mit einem Arbeitspensum von vielleicht 10%. Das heisst zweimal zwei Stunden pro Woche. Das funktioniert mittlerweile extrem gut. Dies ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Massnahme im Vergleich zu anderen Wiedereingliederungen. Mittlerweile ist dies aber akzeptiert worden und es gibt viele wohlwollende Arbeitgeber.
Was braucht es nebst der Kooperation mit dem Arbeitgeber, damit die Wiedereingliederung gelingt?
Aus meiner Erfahrung gibt es eine Patientengruppe, die den Job behalten kann und einfach lange krankgeschrieben ist. Sie hat oft intern einen Coach, der sie unterstützt. Nicht nur die Dauer der Arbeit ist wichtig. Häufig frisst Stress einfach extrem viel Enerige. Beim Wiedereinstieg in den Job versuchen wir in solchen Stressfällen dafür zu sorgen, dass die Patienten klar definierte Aufgaben zugewiesen bekommen. Zum Beispiel: Jemand beantwortet nur die Mails oder arbeitet ganz vorsichtig an einem Projekt.
Sie sprechen sich also bei der Wiedereingliederung für eine sehr langsame Vorgehensweise aus?
Ja, kleine und langsame Schritte sind wichtig. Wir gehen von 10 auf 20 und dann auf 40%. Und nach jedem Verlauf warten wir zu, bevor wir weiter steigern.
Wird Long-Covid weiterhin bestritten von den Versicherungen?
So wie ich das überblicke, gibt es mittlerweile Anmeldungen bei der IV. Viele haben sich bisher gar nicht angemeldet, weil sie nicht in diese Mühle geraten wollen. Sie haben Angst davor. Die Taggeldversicherung kann gleich wie die IV ein Gutachten in Auftrag geben. Das heisst, dass jemand, der betroffen ist, irgendwo zu einer zertifizierten Gutachterstelle geschickt wird, wo dann eine ausführliche Abklärung erfolgt. Meistens recht intensiv für die Betroffenen, irgendwo in der Schweiz. Man kann sich vorstellen, wenn jemand mit halbleeren Akkus von Chur nach Basel muss und dort sechs Stunden Abklärungen hat, ist das nicht sehr förderlich für die Genesung. Aber das ist ein anderes Thema. Auch kann es passieren, dass sich die Gutachter nicht mit dem Krankheitsbild auseinandergesetzt haben, andere Massstäbe zugrunde legen und auch zum Schluss kommen können, dass der begutachtete Patient arbeitsfähig ist.
Was würden Sie ändern?
Man müsste sich überlegen, Long Covid-Gutachten in einem Kompetenzzentrum zu zentralisieren; denn diese Krankheit ist noch so neu, dass es sinnvoll sein könnte, dass es zwei, drei Abklärungsstellen gibt, die sich damit auskennen.
Welche Fehler kann man vermeiden?
Dass man die Leute zu schnell, zu fest unter Druck setzt. Oder wenn man die Art der Arbeit nicht anpasst und in kurzer Zeit wieder sehr viele Aufgaben übernommen werden müssen. Da sollte man schon vorsichtig sein.
Welche Erfahrungen wurden bisher gemacht hinsichtlich irreparabler Nachwirkungen einer Covid-Infektion?
Genaue Zahlen kenne ich nicht. Aber es werden einige Betroffene bleiben, die nicht mehr zurück können in ihren Job. Und da es häufig relativ junge Leute sind, müssen wir eine Lösung finden für diese Menschen. Die Gesellschaft muss schauen, die Wiedereingliederung zu ermöglichen. Ich habe den Eindruck, dass sich die IV-Stellen bemühen.