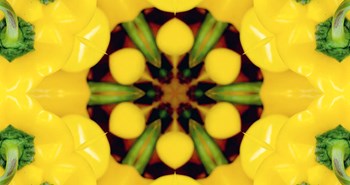Die Rolle der Gewerkschaften sei sehr wichtig, sagte Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB), anlässlich der Jahresmedienkonferenz des SGB. Dies habe sich zuletzt angesichts der anziehenden Teuerung gezeigt. Zwar sei es für eine Bilanz zur Lohnentwicklung noch zu früh. Dort, wo die Gewerkschaften verhandelt hätten, lägen die Zuwächse aber nahe an der Teuerung. Der SGB anerkennt zwar, dass es in vielen Branchen Lohnerhöhungen gegeben habe. Die Lohnschere gehe aber wieder auseinander.
Lohnschere geht auf
Laut dem SGB-Verteilungsbericht erhalten Berufstätige mit tiefen und mittleren Löhnen heute real weniger Lohn als 2016. Aufwärts gegangen sei es nur bei den obersten 10%. Die Entwicklung gehe in die falsche Richtung, kritisierte Maillard - auch wenn die Lage in der Schweiz besser sei als in anderen Ländern. Eine ausgewogene Wohlstandsverteilung stärke die Demokratie, betonte der Waadtländer SP-Nationalrat.Die Lohnoffensive sei deshalb nötig, sagte SGB-Chefökonom Daniel Lampart. 2023 seien daher Reallohnerhöhungen sowie die Wiedereinführung des automatischen Teuerungsausgleichs notwendig. Lampart hält fest: «Ein Lohn muss zum Leben reichen, das heisst konkret: keine Löhne unter 5000 Franken für Berufstätige mit Lehre und mindestens 4500 Franken für alle.»
Rückschritte bei der Gleichstellung
SGB-Vizepräsidentin Vania Alleva kritisierte Rückschritte bei der Gleichstellung. Tieflöhne von unter 4000 Franken etwa im Detailhandel, in der Reinigungsbranche oder in der Pflege seien inakzeptabel. In Tieflohnbranchen seien die Reallohnverluste besonders hoch - und Frauen seien dort übervertreten. Rückwärts statt vorwärts gehe es auch bei den Renten. Es habe sich gezeigt, dass die Befürworter einer Erhöhung der Frauenrentenalters im Abstimmungskampf «nichts als leere Versprechungen» gemacht hätten.
Nötig sei neben Lohnerhöhungen auch eine Reduktion der Arbeitszeiten, so die Präsidentin der Gewerkschaft Unia. Sie verwies dabei insbesondere auf den Pflegenotstand. Viele Pflegende reduzierten heute aus Not auf eigene Kosten ihr Pensum, rund 300 Pflegende flöhen derzeit jeden Monat aus ihrem Beruf.