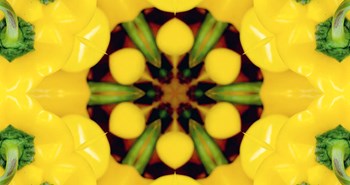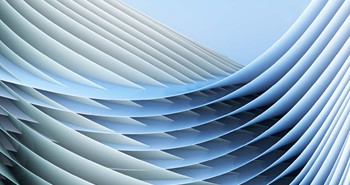Die Lebenserwartung steigt. Diese erfreuliche Tatsache bringt Finanzierungsprobleme in der Altersvorsorge mit sich. Was sollen wir tun? Am naheliegendsten wäre ja, länger zu arbeiten. Das kommt beim Volk aber nicht an. Wie wollen Sie das den Menschen schmackhaft machen?
Da komme ich zurück auf meine Antwort auf die erste Frage. Es gab einen Gegenvorschlag zur Renteninitiative, der aber im Parlament scheiterte. Darin wäre vorgesehen gewesen, Menschen mit wenig Einkommen eine frühere Pensionierung und eine höhere Rente zu ermöglichen. Gutverdiener hätten im Vergleich ein oder zwei Jahre länger arbeiten müssen. Das Referenzalter müsste angehoben werden – mit entsprechenden Ausnahmen für die «Working Poor». Nur mit Steuersenkungen und anderen Anreizen kann man zu wenige motivieren, bis 65 oder länger zu arbeiten. Wer es sich leisten kann, neigt eher zu einer Frühpensionierung. Wir haben bereits eine Flexibilisierung mit der Möglichkeit einer Teilpensionierung, kombiniert mit einem Rentenvorbezug oder -aufschub. Was ich allerdings von den Ausgleichskassen höre, ist, dass sie viel Aufwand betreiben, um für die Versicherten alle Optionen zu rechnen, aber effektiv würden sich die Versicherten selten für einen Teilaufschub der Rente entscheiden.
Wenn es politisch nicht machbar ist, das Referenzalter zu erhöhen, müssen wir dann mehr einzahlen?
Die Schmerzgrenze wird irgendwann erreicht sein. Die Belastung der Erwerbstätigen wie auch der Arbeitgebenden durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nimmt ohnehin zu. Die Sandwich-Generation – also jene, die nicht mehr zur Schule gehen und noch nicht im Pensionsalter sind – wird zu hohe Lasten stemmen müssen und hinterfragen, ob es sich noch lohnt, viel zu arbeiten. Steuern und Transferleistungen sind die grössten Ausgabenposten des Mittelstands. Dazu kommen noch die Miete und weitere Fixkosten. Der frei verfügbare Betrag wird immer kleiner. Das entspricht nicht meinem Idealbild einer freien Gesellschaft, die entscheiden kann, wie sie ihr Geld ausgeben möchte. Daher: Nein, eine grundsätzliche Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge sehe ich nicht als gangbaren Weg.
Sie haben die Flexibilisierung des Altersrücktritts durch die Reform AHV 21 angesprochen. Das wäre doch eine gute Basis für Bogenkarrieren: Verantwortung und Pensum im Referenzalter reduzieren und dafür noch etwas länger arbeiten. Was halten Sie von solchen Modellen?
Bogenkarrieren finde ich im Grundsatz super. Aber sie werden noch nicht in der Breite gelebt. Woran liegt das? Fragen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu wenig danach? Häufiger dürfte es unfreiwillig sein: Der Arbeitgeber stellt den Nachfolger ein und bietet dem bisherigen Stelleninhaber an, bei reduziertem Pensum noch den Neuen einzuarbeiten. Ich glaube aber, dass dieser gesellschaftliche Wandel kommen wird. Ich kenne bereits einzelne Beispiele in meinem Umfeld, die es geniessen, mit 40% noch ein paar Jahre weiterzuarbeiten. Langfristig werden Hierarchien an Bedeutung verlieren. Damit wird auch ein möglicher Gesichtsverlust durch eine Bogenkarriere unwahrscheinlicher.
Die Altersvorsorge wird auch durch veränderte Arbeitsmodelle beeinflusst. Immer mehr Erwerbstätige arbeiten Teilzeit, zahlen daher weniger in die AHV und die Pensionskasse ein. Sehen Sie das als eine Herausforderung, die im Gesetzgebungsprozess gelöst werden muss?
Ja, das sehe ich als eine Notwendigkeit. Im BVG wäre eine Anpassung an die Parameter der AHV gut. Die Senkung oder Abschaffung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzugs wäre ein guter Schritt. Allerdings würde ein Ausbau des Obligatoriums auch eine Anpassung des Umwandlungssatzes bedingen. Der Wunsch der Linken, nur der Flexibilisierung Rechnung zu tragen, hilft nicht. Dadurch würde die Verzinsung der Altersguthaben für die Erwerbstätigen noch schlechter.
Teilzeit und das Ausscheiden der Boomer aus dem Erwerbsleben verstärken den Fachkräftemangel. Oder sehe ich das falsch?
Im Moment arbeitet der Durchschnittshaushalt mehr als früher. Zweimal 70% sind mehr als einmal 100%. Generell sind die Flexibilisierung und die Zunahme von Teilzeiterwerbstätigkeit gut, solange das Durchschnittspensum insgesamt zunimmt. Wir können den Wohlstand nicht ohne Arbeit erhalten. Es wäre eine Verschwendung der Ressourcen, wenn ein Grossteil der gut ausgebildeten Frauen und Männer nicht arbeiten würde. Ich teile die pauschale Kritik an Teilzeitarbeit nicht. Jede Person, die arbeitet, ist ein Gewinn.
Wäre es ein Ansatz, die Ergänzungsleistungen (EL) grosszügiger auszugestalten, statt Wege zu suchen, wie tiefe Einkommen eine bessere berufliche Vorsorge aufbauen könnten?
Das ist ein Weg, den wir aktuell in einem gewissen Sinn gehen. Wir diskutieren im Parlament eine Vorlage, die die EL für Unterstützung und Betreuung zu Hause ausbauen will und so den Eintritt in Pflegeheime hinauszögert. Von linker Seite haben die EL noch immer einen schlechten Ruf, sie sind aber ein sehr gutes Instrument. Anspruch auf EL kann aber unabhängig davon entstehen, ob ich mein Leben lang in der Schweiz gearbeitet oder Beitragslücken habe. Ich würde es daher letztlich bevorzugen, die Renten zu verbessern und nicht nur die EL. Ich möchte keinen Anreiz schaffen, dass viele ältere Arbeitnehmende in die Schweiz kommen, um in erster Linie von den in Aussicht stehenden EL eine sorgenfreie Pension zu geniessen.
Sie möchten also grundsätzlich die Renten bei Geringverdienern verbessern. Wäre es eine Option, bei Teilzeiterwerbenden auch auf dem «Freizeit-Teil» Sozialversicherungsabgaben zu erheben – analog der Beitragserhebung von Nichterwerbstätigen?
Wenn das rentenbildend wäre, könnte man sich das überlegen. Allerdings sähe ich das eher im freiwilligen Rahmen. Ich hatte zum Beispiel die Idee lanciert, im BVG bei reduziertem Pensum weiterhin den bisherigen vollen Lohn zu versichern. Ein solches Modell ist heute erst ab 55 Jahren möglich und sollte freiwillig bleiben.
Weitere Veränderungen ergeben sich infolge der Digitalisierung und der Zunahme von Plattformarbeit und Selbständigkeit. Braucht es Anpassungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen respektive der Unterstellung?
Da sind wir mit der parlamentarischen Initiative Grossen dran. Ich unterstütze den Vorschlag, dass Plattformen die Möglichkeit, ja die Verantwortung erhalten sollen, Beiträge abzurechnen. Damit wird das Armutsrisiko von schlecht abgesicherten Selbständigerwerbenden reduziert.
Müssten Selbständige auch dem BVG und dem UVG obligatorisch unterstellt werden?
Es ist richtig, dass man als Selbständiger die Verantwortung, aber auch die Freiheit hat, eigenverantwortlich zu handeln. Bin ich angestellt, gehe ich davon aus, dass der Arbeitgeber für mich sorgt. Die Selbständigkeit stellt einen Kontrast dar. Man kann sich als Selbständiger aber bereits heute sehr wohl über private Lösungen absichern. Allenfalls braucht es mehr Aufklärung beim Beginn der Selbständigkeit, vermutlich gibt es Ausgleichskassen, die besser aufklären als andere.
Noch gar nicht obligatorisch ist die Krankentaggeldversicherung. Der Nationalrat hat sich kürzlich für ein Obligatorium ausgesprochen. Stehen Sie auch dahinter?
Nein, das finde ich keine gute Idee. Es gibt bereits vielfältige Lösungen, die den Unternehmen und auch Individuen von der Versicherungswirtschaft angeboten werden. Ein Obligatorium würde zu einer Verteuerung führen.
Wie wäre es, statt immer mehr durch Gesetze zu regeln, das eine oder andere zu entpolitisieren – zum Beispiel den Mindestumwandlungssatz im BVG?
Unbedingt! Wir müssten politisch viel mehr mit Zielvorgaben und Leistungszielen statt mit mathematischen Parametern in den Gesetzen arbeiten. Die Stiftungsräte in den Pensionskassen leisten eine sehr gute Arbeit und sind in der Lage, gute Entscheide zu fällen. Es mag ganz wenige schwarze Schafe geben, aber den allermeisten Stiftungsräten könnte man mehr zutrauen, als das der Gesetzgeber heute macht.
Eigenverantwortung und Flexibilität sind zentrale Themen. Eigenverantwortung in der Vorsorge – z.B. durch eine Stärkung der 3. Säule: Könnte das ein Weg sein, um dem sich wandelnden Arbeitsumfeld zu begegnen? Oder ist das ein Weg, den eigentlich nur Gutverdienern offensteht?
Ich wehre mich dagegen, dass die 3. Säule nur ein Steuersparvehikel für Gutverdiener sein soll. Der Einkauf in die 2. Säule ist da viel wirkungsvoller ... Die Säule 3a ist aber ein Vehikel, mit dem der Mittelstand gut vorsorgen kann. Man kann schon mit wenigen Franken jährlich anfangen und sich zusätzliches Kapital fürs Alter ansparen. Von mir aus könnte man die Maximalgrenze aber gern anheben. Die in diesem Jahr in Kraft getretene Möglichkeit, Löcher in der Säule 3a nachträglich zu füllen, ist sehr gut. Leider hat das EDI die Vorlage nicht konsequent umgesetzt. Wäre der nachträgliche Einkauf auch für die letzten zehn Jahre (also 2015 bis 2025) möglich und auch für Jahre ohne AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen, hätte das noch einen besseren Effekt für den Mittelstand.
Gerade in Wissens- oder Schreibtischberufen hat in jüngerer Vergangenheit die Flexibilität zugenommen. Schränkt das Arbeitsgesetz gerade bezüglich Arbeitszeit zu sehr ein?
Ja. Es wird bereits viel flexibler gelebt, als es der Gesetzgeber vorsieht. Es gibt keine Arbeitszeit-Polizei, die kontrolliert, um welche Zeit ich meine letzte E-Mail geschrieben habe oder ob ich am Sonntag den Laptop einschalte. Eine Lockerung im Gesetz würde keine Revolution auslösen, sondern lediglich die Realität besser abbilden.
Besteht denn nicht die Gefahr, dass die Arbeitnehmenden zu schlecht geschützt sind und jederzeit abrufbar sein müssen?
Vieles wie die Erreichbarkeit und arbeitsfreie Zeiten kann man im Arbeitsvertrag regeln. Es gibt kaum starke Gewerkschaften für die IT- oder Finanzbranche. Das liegt daran, dass diese gut bezahlten und ausgebildeten Fachkräfte eine gewisse Marktmacht haben. Die Unternehmen sind froh, wenn sie gute Leute finden. Der Arbeitskräftemangel stärkt die Stellung dieser Arbeitnehmenden. Entsprechend können sie immer mehr dem Arbeitgeber diktieren, was im Vertrag steht.
Take Aways
- Die Sozialversicherungen müssen reformiert werden, um das System zukunftsfähig zu machen. Eine Lösung könnte laut Andri Silberschmidt sein, tiefe Einkommen mit einer höheren Ersatzquote zu versehen, um andere Massnahmen beliebter zu machen.
- Das Referenzalter muss steigen, allerdings sollen Personen mit niedrigen Einkommen früher in Rente gehen können, während Gutverdiener etwas länger arbeiten.
- Eigenverantwortung spielt künftig eine grössere Rolle. Alle sind gefordert, ihre Altersvorsorge mit einer 3. Säule zu stärken, und Selbständige müssen ihre Risikovorsorge selbst in die Hand nehmen.
- Das Arbeitsrecht sollte flexibilisiert werden, um den modernen Arbeitsrealitäten Rechnung zu tragen.