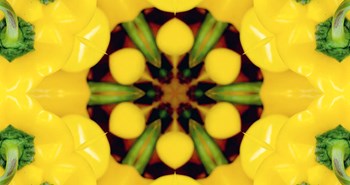In der Schweiz wurden 2021 rund 11% des Bruttoinlandprodukts (BIP) für das Gesundheitswesen ausgegeben, im Jahr 1960 waren es noch 4%. Der Trend zeigt also nach oben, wie Jan-Egbert Sturm, Direktor der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich, in seinem Referat aufzeigte – und er geht davon aus, dass dieser Trend anhält. Sturm betonte, dass man von Ausgaben und nicht von Kosten sprechen solle, denn die Ausgaben seien ja gewollt. Die Ausgaben seien aber nur eine Seite der Medaille, denn zwischen 1990 und heute ist auch die Wertschöpfung im Gesundheitswesen von 4 auf 8% des BIP gestiegen und 13% aller Beschäftigten in der Schweiz arbeitet im Gesundheitswesen.
Schweizer Gesundheitswesen steht im internationalen Vergleich gut da
Sturm stellte zudem fest, dass man in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern viel fürs Geld bekomme. So seien beispielsweise die Ausgaben in den USA mit 17% des BIP deutlich höher (siehe Grafik), die erbrachte Leistung aber schlechter, wie er anhand einiger weiterer Daten festmachte. So stieg in der Schweiz die Lebenserwartung bei Geburt zwischen 1990 und 2022 von rund 77.5 auf 83.5 Jahre; in den USA lediglich von 75 auf 77 Jahre. Auch im Vergleich mit den meisten europäischen Ländern stehe die Schweiz gut da. Lediglich in Italien scheine es seit einigen Jahren zu gelingen, mit tieferen Ausgaben ein ähnlich hohes Leistungsniveau zu erreichen.
Daraus folgerte Sturm, dass hohe Ausgaben allein noch kein gutes Gesundheitswesen garantierten. Er gehe aber auch davon aus, dass der Trend der steigenden Kosten anhalten werde, was auch in Ordnung sei, so lange auch eine entsprechende Leistung daraus resultiere.
Welches Land ist besser: Schweiz oder Schweden?
Einen Vergleich der Systeme präsentierten Jérôme Cosandey, Forschungsleiter Tragbare Sozialpolitik bei Avenir Suisse, und SRF-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Sie gingen der Frage nach, welche Regulation das Gesundheitswesen brauche – mehr Markt oder mehr Staat? Dazu verglichen sie die Schweiz mit Schweden.
Kaufmann erklärte das schwedische System, das in erster Linie dadurch auffalle, dass sämtliche Gesundheitskosten durch Steuermittel finanziert würden, und die Behandlungen für die Patienten zu 100% gedeckt seien – abgesehen von einer Praxispauschaule von rund 10 Franken, die allerdings auf jährlich rund 100 Franken gedeckelt sei. Vorbildlich am schwedischen Gesundheitswesen fand Kaufmann zudem die weit fortgeschrittene Digitalisierung. Mittels App könne mit wenigen Klicks ein Termin abgemacht oder eine erste Beratung beansprucht werden. Allerdings habe das System auch Nachteile. In den letzten Jahren sei die Gesundheitsversorgung stark zentralisiert worden. Es gebe nur noch wenige Zentrumsspitäler ergänzt durch Notfallzentren auf dem Land. Fachpersonal sei rar und die Fachleute zögen es vor, in den Städten zu arbeiten. Dies führe dazu, dass – wenn es sich nicht um einen Notfall handle – die Bevölkerung längere Wartezeiten bis zu einer Behandlung in Kauf nehmen müsse und die Behandlung unpersönlicher sei. Einen Hausarzt hätten die wenigsten und die Anreise zu einem Spital sei entsprechend weit. In Stichworten zusammengefasst sei das schwedische System modern und demokratisch; wegen der vernachlässigten Grundversorgung gebe es aber eine harte Triage.
Mehr Hausärzte, kürzere Wartezeiten, höhere Lebenserwartung
Jérôme Cosandey attestierte den Schweizern eine Allergie gegen Machtkonzentration, die sich im Föderalismus manifestiere. Der Föderalismus fördere im Gesundheitswesen eine Differenzierung und Innovation. Es gebe einen Wettbewerb der Ideen die in 26 «Versuchslaboren» getestet würden. Was sich bewähre, würde von anderen Kantonen übernommen.
Im direkten Vergleich der Zahlen, den Cosandey präsentierte, zeigen sich leichte Vorteile für das marktwirtschaftliche System der Schweiz. So verfügten mehr Schweizer über einen Zugang zu einer Hausarztpraxis (93 zu 87%), und in der Schweiz erhalte man häufiger einen OP-Termin innert eines Monats (50 zu 23%). Auch die Lebenserwartung sei in der Schweiz mit 83.2 Jahren etwas höher (Schweden: 82.5; siehe Grafik). Die BIP pro Kopf Ausgaben seien in der Schweiz mit rund 70000 zu 55000 US-Dollar in Schweden auch höher. Letztlich attestierte Cosandey der Schweiz und Schweden ähnliche Herausforderungen: Der Stadt-Land-Graben sowie die Spitalplanungen. Wo die Skandinavier der Schweiz voraus sind, sei eindeutig die Digitalisierung.
Ärzte entwickeln ihre Arbeitsweisen weiter
Davon konnte Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin der FMH, ein Lied singen. Sie wie auch viele weitere Referenten spielten auf die Meldung von übertragbaren Krankheiten an, die bis zum Beginn der Corona-Pandemie per Fax ans BAG gemeldet werden mussten. Das sei heute etwas besser, so könnten heute die Infektionen mit Covid-19 und Influenza digital gemeldet werden, über 50 weitere meldepflichtige Krankheiten müssten aber auch heute noch per Fax, Post oder allenfalls Telefon gemeldet werden.
Die Arztpraxen selbst würden sich im Digitalisierungsgrad stark unterscheiden. Während alteingesessene Ärzte, die kurz vor der Pensionierung stünden, keine grossen Investitionen mehr in die Digitalisierung ihrer Praxis mehr machten, seien junge Gemeinschaftspraxen sehr weit. Handschriftliche Krankengeschichten würden immer seltener. Diese seien mittlerweile zu zwei Dritteln digital und würden so auch strukturierte Daten liefern, die für sinnvolle Auswertungen genutzt werden könnten. Schliesslich regte Gilli an, das elektronische Patientendossier (EPD) schnell weiterzuentwickeln und ihm endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Es müsse mehr sein, als eine Dokumentensammlung für interessierte Patienten: Ein Kommunikationsinstrument für alle Leistungserbringer und Patienten, das die Behandlungsprozesse unterstützt.
Digitalisierung muss praktischen Nutzen bringen
Die Digitalisierung sei kein Wunderwerk, das menschliches Agieren ersetzen könne, sagte Stefan Siegrist, Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E.. Es sei nicht sinnvoll, alles zu digitalisieren, was technisch möglich sei, sondern nur, was im Alltag für Patienten oder Leistungserbringer einen Nutzen bringt. Zum Beispiel die einfache Suche eines Artzes ohne dazu 20 Websiten öffnen zu müssen. Wichtig ist in den Augen von Siegrist auch sicheres und einfaches Nutzen von Daten. Dazu müssten die Betroffenen aber überzeugt werden, dass Sie mit der Zurverfügungstellung ihrer Daten für die Gesellschaft etwas Guten tun würden. Daten Teilen sei wie Blutspenden. Dazu brauche es Vertrauen, das auch durch klare Regeln für den Umgang mit den Daten geschaffen werden müsse. Dem Staat als Regulator komme hier die Rolle des Enablers zu.
Wir bräuchten die Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) als Hilfsmittel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sagte Tobias Kober, Direktor des Schweizer Innovationshubs von Siemens. Dabei dürfe die Benutzung der Tools keine Mehrarbeit erzeugen, das sei wichtig für die Akzeptanz. Zudem müssten wir eine neue Fehlerkultur entwickeln. Denn durch die digitale Erfassung von Behandlungen, seien auch Fehler besser nachvollziehbar. Das löse bei den Ärzten Ängste aus – die Folge müsse aber sein, dass wir nicht nach Schuldigen suchen, sondern aus Fehlern lernen. Letztlich solle durch die Digitalisierung eine Entlastung von Pflegefachkräften und Ärzten erfolgen, damit diese mehr Zeit für die direkte Arbeit an den Patienten zur Verfügung haben.
Die Trendtage Gesundheit unterstrichen in ihrem vielfältigen Programm, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz absolut und auch im Vergleich mit anderen Systemen gut ist. Dennoch müssen wir uns darauf einstellen, dass die Ausgaben weiter steigen werden. Es ist mit weiteren Innovationen zu rechnen und im Bereich der Digitalisierung besteht noch Potenzial.
Dieser Text basiert auf Referaten und Diskussionen der Trendtage Gesundheit vom 23. und 24. März 2022. Weitere Informationen zum Kongress: trendtage-gesundheit.ch